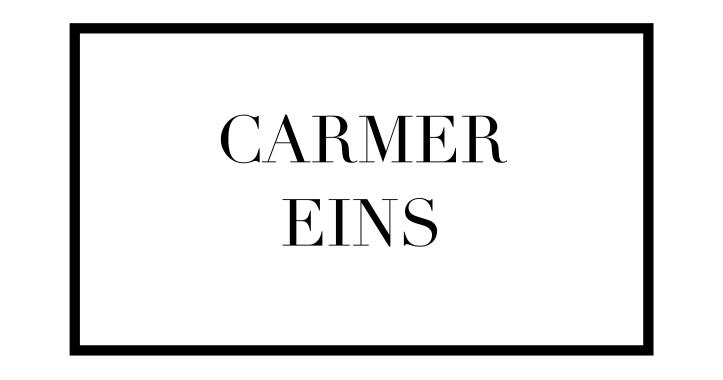Die heutige Lesebühne fand – unter anderem durch einen Fehler in der
Anfangszeitangabe, für den wir uns sehr entschuldigen - in kleinerer
Runde statt.
Den Anfang machte Alexander Reumund mit seiner Erzählung „ein
Arztbesuch“, in der ein Junge von seiner besorgten Mutter gegen
seinen Willen zum Arzt begleitet wird, wo er, im Wartezimmer den
Wolken nachträumend, mit dem Kopf gegen die Scheibe prallt. Das etwas
rätselhafte Ende der Geschichte wurde als zu unvermittelt und
undeutlich in seiner Aussage beurteilt, zumal auch sonst wenig von
dem Jungen zu erfahren sei. Eine Gegenstimme sah jedoch gerade in dem
Ende eine gelungene Symbolik: die Schönheit der Wolken und die
Begeisterung, die sie in dem Jungen auslösten, machten die
(möglicherweise ernste) Erkrankung des Jungen zweitrangig.
Der zweite Text von Alexander Reumund war als Einleitung zu einer
Auseinandersetzung mit Schopenhauer konzipiert und wurde als
interessant, aber nicht literarisch eingestuft. Der letzte Beitrag
des Autors, der 10 – Zeiler: „der Gipfelstürmer“ weckte die meiste
Kritik: Das Gedicht, in dem es um die Schwierigkeit ging, mit
Erreichtem zufrieden zu sein, enthalte nur Allgemeinplätze.
Als nächstes hörten wir Lyrik von Günter Fezer mit dem Titel: „Blaues
Manifest“. Das Gedicht wurde, so der Autor, in den frühen Neunzigern
geschrieben als Hommage an die neue Leichtigkeit der Poesie in der
Postmoderne. Das Gedicht, das insgesamt als gelungen bezeichnet
wurde, weckte nur durch seinen Titel Widerspruch: die Schwere des
Begriffs „Manifest“ passe nicht zu der geforderten poetischen
Leichtigkeit.
Eine besondere Herausforderung für Autor und Zuhörer gleichermaßen
stellte der nächste Beitrag dar Herrn Siechert trug Texte aus dem
Nachlass der verstorbenen Mareike Ged vor, einer Schönebergerin
und Zeitzeugin des Holocaust, die Ravensbrück überlebt hatte und ihr
Leben lang leidenschaftlich geschrieben hat. Herr Siechert hatte sich das
ehrgeizige Ziel gesetzt, den Nachlass von Mareike Ged der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und trug nun, die Stimme der alten
Dame imitierend, humoristisch - nachdenkliche Aphorismen und Essays
aus ihrem Werk vor. Text und Vortrag wurden von einigen Zuhörern als
gelungen bezeichnet, während kritischere Stimmen anmerkten, das Leben
und die offenbar eindrucksvolle Persönlichkeit von Mareike Ged seien
sicher eine Dokumentation wert, nicht jedoch ihre Texte, deren
literarische Qualität sich zumindest aus dem Vorgelesenen nicht
erschließen ließe.
Den Schluss des Abends bildeten drei Gedichte von Nike Huss. In einer
aus medizinischen Fachbegriffen gebildeten, höchst eigenwilligen
Kunstsprache widmet sich die Autorin in ihrem ersten Gedicht
der Stadt Venedig, die sie wie einen Komapatienten
unter das chirurgische Messer legt. In ihrem zweiten Gedicht
behandelt die Autorin die aktuelle Atomkatastrophe und
klagt die unverantwortliche Haltung der Politik an, um dann, in ihrem
letzten Gedicht ganz ins Private zu gehen: die höchst persönliche
Erfahrung der Autorin mit dem Zwang musikalischer Früherziehung und
einer späteren, endlich befreiten Beziehung zur Musik. Die Gedichte
wurden sehr unterschiedlich beurteilt. Während einige Zuhörer
bemerkten, die künstliche Sprache verdecke zu sehr den eigentlichen
emotionalen Impuls der Autorin, sie sei zu kalt, zu medizinisch,
passe nicht mit dem Gesagten überein, gab es auch Stimmen, die den
Texten Eigenwilligkeit und literarisches Potential zuschrieben.
Entsprechend waren es auch die Texte von Frau Huss, die an diesem
Abend die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten.
schoenfeldt - 17. Jun, 15:15
Statt einer ausführlichen Zusammenfassung der Diskussionen der
letzten drei Lesebühnen im Januar, Februar und März, erlauben wir uns einen groben Rückblick und hoffen, im Mai wieder mit detallierteren Reflexionen der Diskussionen aufwarten zu können.
Seit Januar 2011 losen wir, Publikum und Moderation, den besten Text des Abends aus, um die Gewinner jeweils ein halbes Jahr später, also im Juni und Dezember 2011 gegeneinander antreten zu lassen. Gewinnerin der Lesebühne im Januar 2011 war mit eindeutiger
Mehrheit Julia Trompeter, deren Text „Die Mittlere“ in Schleifen um den Versuch kreiste, einen „Plot“ zu entwickeln. Trompeter schaffte es, diese eher theoretisch anmutende Frage literarisch zu fassen und ließ erahnen, wie sehr der Versuch, einen Plot zu entwickeln, Sprache und Form in eine Sackgasse drängt, aus der die einzige Gegenwehr die ist, die Gegenrichtung einzuschlagen und im Gegenstrom einzufangen, was an Erzählbarem bleibt. Das Kontingente ist nicht meine Stärke lautet ein Satz in Trompeters Erzählung. Diese Schwäche aber ist es, aus dem der Text seinen Anschwung nimmt und thomas-bernhardsche Bögen spannt statt rote Fäden zu spinnen. Fritz Kaune las zwei Gedichte, „Das Tao in der Provence“ und „Erkenne die Lage“, die die Themen Erinnerung und Todesnähe bearbeiteten und nach Julia Trompeter die meisten Stimmen auf sich vereinten. Jörn Sack las das Vorwort zu einem Buchprojekt, mit dem
er Voltaire und Rousseau in eine fiktionale und dialektische Beziehung zu setzen plant. Kritisch wurde das Vorwort deshalb betrachtet, da es schon alles verrate und keinen Appetit auf das Kommende mache. Außerdem wurde bemerkt, dass Sacks Text kein iterarischer Text sei, hier aber nur literarische Texte zur Diskussion gestellt werden sollten. Eike Asen las einen Text mit fantastischen Zügen, in dem pflanzenartige Wesen dem menschlichen Protagonisten ihre Welt offenbaren. Gelobt wurde der Text für die Phantasie, die ihm zugrunde läge, die Zeichnung des Pflanzenwesens, die Welt, in die der Text entführe. Kritisiert wurde, dass er zu sehr dem Bestreben,einen Plot zu finden, folge und so die Geschichte ins Eindimensionale dränge.
Im Februar lasen Marianne Rauch, Angelika Oldenburg, Fritz Kaune, Elisabetta Abbondanza und Ute von Arnim. Als bester Text wurde Kaunes Text gekürt, der in erinnerndem Ton Anfang und Ende schöner und schmerzhafter Ereignisse reflektiert. Marianne Rauch stellte
drei Gedichte vor, die, so die Kritik, das Hintergründige vermissen ließen. Als Songtexte seien die Gedichte gut geeignet, als Gedichte aber säßen sie offenbar dem Irrtum auf, dass Lyrik Gefühlsausdruck bedeute, was schon Goethe als weit verbreitetes Missverständnis entlarvt habe. Angelika Oldenburg las einen Text, der in Prosaform das Thema „Stadt“ behandelte. Die Sprache des Textes wurde gelobt, die Passivität der Figur als grenzwertig empfunden, der Text lebe dort, wo sich die Figur verwickle. OLdenburg vereinte nach Kaune die meisten Stimmen auf sich. Elisabetta Abbundanza las die Geschichte einer Frau, die eine vor allem sexuell betonte Affäre neben ihrer Ehe pflegt, was Abbundanza das Lob einbrachte, man habe es hier mit einer emanzipierten Figur zu tun. Dem widersprach man und fragte, was an einem Betrug emanzipiert sei? Der Betrug manifestiere doch eher konservative Rollenmodelle. Abbundanzas Text holte sich auf der inhaltlichen Ebene Kritik ab, sprachlich sei er routiniert, hieß es. Ute von Arnim setzte den Schlusspunkt mit einem Text über das Erwachsenwerden eines Mädchens, das , als es mit Jungs in Berührung kommt, sein Kaninchen tödlich vernachlässigt. Die Vernachlässigung wird im Text zum Zeichen der Reifung. Der Text wurde unterschiedlich aufgenommen, einige konnten ihm etwas Skurriles abgewinnen, andere bemängelten, dass es hier an Tiefe und Hintergründigkeit fehle.
Die März-Lesebühne wurde von drei Autoren bestritten: Michael Leisching, Wolfgang Priewe und Stephan Schwarz. Den Anfang machte Wolfgang Priewe mit einem Romanausschnitt über die Begegnung eines Kohlenträgers mit einem harz-4-gestützten Computerfreak. Der Text gewann sein Publikum, wurde für Verschiedenes hoch gelobt: Vor allem für die Gestaltung der Figuren, die einen neugierig machten, dann für die Konfrontation/Berührung der zwei Welten, jener, die unterginge mit der, die die Moderne repräsentiere. Auch sprachlich erntete der Text nur Lob. Kritische Stimmen blieben aus bis auf eine, die anmerkte, dass der Text die Gefahr berge zu idyllisieren, zu schön zu finden, wovon er erzähle. Der Autor solle die Distanz zu seinem Stoff halten.
Auf Priewe folgte Michael Leisching, der mit einem Zettelkasten ans Lesepult trat und sein „Gesamtkunstwerk“ vorstellte. Der Zettelkasten trägt den Namen „ Die Rebellion der Schleimhäute red box volume II“ und versammelt kürzeste Prosa, manchmal nur Sätze, eher Aphorismen zu verschiedenen Themen. Der Kasten beherbergt drei Abteilungen: „Philosophie“, „Politik“ und „Ästhetik der Abwesenheit“. Leisching trug jeweils drei Prosaversatzstücke aus den drei Abteilungen vor und verteilte anschließend die Karteikarten, auf denen sie vermerkt waren. So konnte das Publikum feststellen, dass die Stücke zum Teil anarchischer Orthographie folgten, was im Vortrag nicht hörbar gemacht werden kann. Das ganze Projekt an sich
wurde gelobt als Ausdruck nicht konventionell sein wollender Literatur bzw. Kunst.
Der Charme der gesamten Performance mache manche Schwachstelle in
den Prosastücken wieder wett, lade sogar mit ihnen zur Nachahmung ein.
Den Schlusspunkt markierte Stephan Schwarz, der mit einem in jüngster Zeit entstandenen Text aus seinem „Benjaminfeld-Projekt“ auftrat. Reifer als die im Vorjahr vorgestellte Passage sei diese hier, hieß es. Ähnlich wie der ältere Text mäandere dieser sich in Felder, die das Verstehen, gerade auch beim Zuhören im Gegensatz zum Lesen, erschwerten, die dem Leser die Entscheidung überließen, was er aufnehmen und wo er abschweifen wolle. Das wurde von den einen als sehr gelungen, von den anderen als Zumutung empfunden. Insgesamt hatte der Märzabend einen sehr experimentellen Charakter, was die Veranstalterinnen begrüßen. Von einer Abstimmung wurde abgesehen, da die Texte bzw. Kunstwerke nicht miteinander zu
vergleichen seien. Stattdessen wurde beschlossen, alle drei Autoren im Juni antreten zu lassen und die Abstimmungslesung in zwei Kategorien einzuteilen, in jene, die eher konventionelle Texte (wertfrei gemeint) versammelt und eine zweite, die Experimentelles“ birgt, um so eine bessere Vergleichsbasis zu schaffen.
schoenfeldt - 21. Apr, 13:33
Die sechs AutorInnen Albert Liberg, Friederike Graeff, Conserve, Hillert Ibbeken, Esther Andradi und Johannes Groschupf bestritten die Lesungen der Dezember-Ausgabe von Carmer Eins und riefen mit ihren Texten mal wieder grundlegende Fragen zur Literatur auf den Plan.
Albert Libergs Text erzählt von einem Angestellten, der beim bewusst erlebten Sturz in den Tod sein Leben in groben Zügen Revue passieren lässt, um dann in einer Unterwasserwelt zu landen, die sich als Reich der Ewigkeit entpuppt. Der Text, so die mehrheitliche Meinung des Publikums, zerfiele in zwei Teile, die zugleich auch seine zwei Optionen enthielten: in den ersten –Rückblick aufs eigene Leben –, der sehr spannend sei und in den zweiten, der den Blick in die Ewigkeit werfe und eher Langeweile aufkommen lasse. Die Langeweile der Ewigkeit sei es ja gerade, die er darstellen wolle, erklärte der Autor. Ob das funktioniere, Langeweile darzustellen, ohne dabei langweilig zu werden, sei die Frage. Der Text rieche nach „Angestelltenprosa“ – Murren im Publikum – und laufe Gefahr, den Angestellten im Klischée zu ersticken. Vereinzelte Zustimmung.
Auch Friederike Graeffs Text hat eine Angestellte zur Hauptfigur. Erzählt wird von der Verbindung zwischen dieser Frau, die plötzlich Eier legt, und dem wegen Betrugs entlassenen Kollegen, den sie bei seiner Suche nach einer neuen Arbeit heimlich unterstützen will. Die Geschichte beeindrucke durch den parataktischen, pointierten Stil der Sprache und die erklärungs- und kommentarlose Darstellung der Frauenfigur, die die Tatsache, dass sie Eier legt, hinnehme wie all die bürokratischen Akte, die sie täglich zu verrichten habe, meinte ein Teil des Publikums, während der andere den Begriff der „Angestelltenprosa“ zum zweiten Mal in Runde warf und fragte, ob wir dieser Epoche nicht schon entronnen seien. Es dränge sich die Frage auf, ob „Angestelltenprosa“ unsere Wirklichkeit noch einfangen könne. Was denn „Angestelltenprosa“ sei, ob Kafka dann auch dazuzuzählen sei und ob Kategorisierungen wie diese hilfreich seien, lautete die empörte Gegenfrage. Der Text Graeffs mag in die Richtung von „Angestelltenprosa“ gehen, sei jedoch bitterböse ironisch und das mache ihn interessant, gemahnte einer der Kritiker. Jedoch, fuhr der Kritiker fort, eröffne sich damit auch die Frage nach dem Sinn von Literatur: Heute müsse sie Trost spenden. Widerspruch. Was das denn heiße: Trost spenden? Wie man immer wieder das Wort „müssen“ im Munde führen könne! Was das solle! Michel Houellebecq z. B., fuhr der Kritiker unbekümmert fort, spende nichts, gebe mit seinen Texten nichts. Aber wir bräuchten Trost. Zuspruch und Widerspruch. Ob Trost wirklich nötig sei oder ob es nicht eher darum ginge, etwas zu wagen, ob Literatur heute nicht viel zu selten etwas wage, ob nicht das Meiste braves Zeug sei. Es müsse doch darum gehen, das Unerträgliche noch unerträglicher zu machen!
Der folgende Text verschaffte sich dann auf eher spektakuläre Weise Gehör: der Dichter Conserve rezitierte frei eine Art manischer Rede oder lyrischen Rap, der um das Wortfeld Licht kreiste, viele Redensarten aus diesem Wortfeld wieder belebte, indem er durch eine entsprechende Kontextualisierung ihren wörtlichen Sinn wieder hörbar machte. Die Redewendung „hinters Licht führen“ z. B. gewann ihren wörtlichen Sinn durch den Kontext von „Himmel“, „Universum“, „Stern“ etc. wieder. Das sei genial gewesen, platzte es aus einer Zuhörerin heraus. Der folgenden Frage, ob das eine Improvisation gewesen sei, begegnete Conserve mit angenehmer Bescheidenheit, als er sagte, dass wäre dann wohl wirklich genial, nein, er habe an dem Text lange gearbeitet, Stück für Stück. Der reiche metaphorische Fundus, aus dem der Dichter schöpfe, sei imponierend, die sprachliche Gestaltung mal mitreißend, mal überfordernd. Sich hinstellen und Verse rezitieren, wo da noch der Unterschied (im positiven Sinne) zwischen Schiller und heute sei? Kurz und gut: die Leidenschaftlichkeit des Vortrags nahm das gesamte Publikum so sehr in Anspruch, dass eine spontane kühle Beurteilung ausblieb. Im Nachhinein stellte sich uns die Frage, ob es eigentlich einen Inhalt gab, oder ob sich der Text im Sprachexperimentellen erschöpft – was für einen mündlichen Vortrag auch vollkommen ausreicht, dann aber eher als Musik denn als Literatur zu verstehen ist, die sich auch dem Gelesenwerden stellen muss.
Nach einer kurzen Pause trat Hillert Ibbeken ans Pult und machte vor der Lesung seiner Sorge Luft, dass er nicht sicher sei, ob er mit seinem Text aus der Masse braver Literatur heraussteche. Der Text beschreibt den Aufenthalt des Erzählers mit seiner Lebensgefährtin in einem kleinen italienischen Dorf während eines religiösen Festes. Bevor das Fest sein Ende in einer Kirche findet, verlässt das Paar die heiligen Hallen, froh, dem ermüdenden Ritual entkommen zu sein. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: der Text sei eine Mischung aus akademischer Betrachtung und autobiografischer Erfahrung und deshalb eher beim Sachbuch anzusiedeln. Die Flucht der Bildungsbürger aus der Kirche wirke hochnäsig. Uneinigkeit herrschte über die Wirkung der autobiografischen Passagen, die manche als „zu privat“, andere als die interessantesten Stellen des Textes empfanden.
Esther Andradi, argentinische Autorin, deren Texte in deutscher Übersetzung erscheinen, las einen kurzen Text, der sehr verdichtet, fast lyrisch von der Begegnung einer Dame mit einem Kriegsmann in einem Kriegsgebiet erzählt und um die Frage der Abwesenheit und der Sehnsucht nach einer Sprache der Liebe kreist. Nach einer eher verhaltenen Reaktion seitens des Publikums, das offenbar nicht so recht wusste, was es von dem Text zu halten habe, erklärte die Autorin, dass der Ort, in dem die Begegnung stattfinde, Afghanistan sei, dass der Krieg der Alexander des Großen sei. Manche hatten das schon verstanden, andere warfen ein, dass das für das Verständnis des Textes nicht wichtig sei, dass man den Text auch abstrakt lesen könne, als eine allgemeine Aussage über Mann, Frau, Krieg und Liebe. Der Dichter Conserve bemerkte, dass ihn das Wort „Dame“ gestört habe. Zustimmung. Damit war die Frage der Übersetzung bzw. der Bedeutungsunterschiede zwischen dem deutschen Wort „Dame“ und dem spanischen Wort „dama“ auf dem Tisch. Andradi sagte, dass sie das deutsche Wort gut kenne und dass es keine Bedeutungsunterschiede gebe. Widerspruch von einer der spanischen Sprachen mächtigen Zuhörerin, die sagte, da gebe es doch Unterschiede. Der deutschen „Dame“ hafte nichts Würdiges mehr an, der spanischen hingegen schon. Die Dichterin schlug vor, bei kürzeren, lyrisch ausgestalteten Texten, diese unter dem Publikum zu verteilen. Diesen Vorschlag nehmen wir gerne an!
Die Lesung schloss ein Text Johannes Groschupfs ab, der mit seiner autobiografischen Erzählung „Zu weit draußen“ das literarische Feld 2005 eroberte. Der Text wirft einen Blick in drei Neuköllner Kneipen, erzählt von ihren Besuchern und ihren unerfüllten Wünschen. Eine Ich-Figur taucht sehr sparsam und hintergründig auf. Ihre stille Frage, was man sich wünsche, wird in den Buden unerfüllter, enttäuschter Wünsche eher als Provokation, nicht als Einladung empfunden.
Die Reaktionen waren wie immer unterschiedlich. Während die einen die Geschichte berührend, ihr Lokalkolorit gekonnt fanden, sahen die anderen das Klischée durch den Text galoppieren, der so vor sich hinplätschere.
Am häufigsten fiel in der Diskussion des Abends der Vorwurf, Klischees zu bedienen. Die Frage, ob denn Klischees nicht auch, wenn auch in erschreckender Weise, nah an der Wirklichkeit seien, viel näher als uns lieb ist, blieb unbeantwortet.
schoenfeldt - 20. Apr, 13:55
1. Muss Kritik immer konstruktiv sein?
2. Ist es sinnvoll/nötig, Literatur von Männern und Frauen zu unterscheiden?
3. Gibt es Kritierien für gute und schlechte LIteratur? Und wenn ja, welche?
schoenfeldt - 12. Dez, 18:11
Die Texte der Lesung vom 28.11.2010 (alle hier nachzulesen) waren sehr unterschiedlichen Charakters und Tiefenniveaus, wie die Diskussion herausstellte. Susanne Schmidts Text machte den Anfang und musste sich einiger Kritik stellen. Beargwöhnt wurde vor allem das „wir“ des Textes, das den Leser vereinnahme, ihm eine Sicht der Welt aufzwinge, die dieser vielleicht gar nicht habe. Beispielsweise empfanden mehrere ZuhörerInnen den von Schmidt im Text als grau, dunkel und einsam dargstellten Winter eben nicht als grau, dunkel und einsam, sondern eher als mal mehr, mal weniger angenehm bunt. Wenn man vereinnahmen wolle, sollte das bewusster geschehen als es im Text nach dem Eindruck der Kritiker geschehe.
Jörn Sack stellte zwei experimentelle Prosaminiaturen vor, deren sprachliche (rhythmische) Gestaltung gut ankam. Diskutiert wurden die Schlusssätze beider Texte bezüglich der Frage, ob sie den jeweiligen Text abrundeten (so ein Teil des Publikums) oder ihm eine Deutung aufzwängten, die sein Assoziationspotenzial zu Gunsten einer fragwürdigen Aussagewilligkeit belaste und einschränke.
Texte mit experimentellem Charakter sollten, so ein Teilnehmer, viel mehr gefördert werden und es wäre doch schön, wenn die Lesebühnen-Macherinnen des Buchhändlerkellers dazu einlüden. Dies wollen wir hiermit tun!
Gar nicht experimentell, aber sehr ausgereift (und auch schon veröffentlicht, was eigentlich ein Tabu für die Lesebühne ist, in diesem Fall aber zugelassen wurde, da der Band, aus dem Jenny Schon las, neu aufgelegt wird) wirkte die Erzählung Jenny Schons von einer ungewollten Erinnerung auf das Publikum. Uneinigkeit herrschte über den ersten Teil der Erzählung, den manche ausgesprochen gelungen, sprachlich sehr schön und ansprechend fanden, andere für zu lang hielten. Letztere fanden die Erzählung erst ab jenem Punkt spannend, wo die Erinnerung einsetze. Streit gab es auch darüber, ob das Wort „Gummibärchen“ in den Text passe. Es falle, so die Kritik, aus der Sprache, die eher als ahistorisch bzw. zeitlos empfunden wurde, heraus.
Den Schluss markierte ein kurzer Prosatext von Robert Schmidt, der bei einem Teil des Publikums gut ankam, bei einem anderen die Frage nach der Aussage auslöste: ob diese sich darin erschöpfe, dass manche Menschen Buckelwale, andere Pottwale seien. Das sei zu wenig. Weshalb der Text von Seiten dieser Kritik als „hübsch“, aber nicht sehr tief empfunden wurde.
Wir möchten uns bei den Vortragenden bedanken und an dieser Stelle noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass experimentelle Literatur bei uns sehr willkommen ist!
schoenfeldt - 12. Dez, 18:01
Die Waldmarie glitt in ihren Sitz geschnallt über den Aufsetzpunkt der Pollbahn von Halifax, Nova Scotia; denn sie wollte………………………………………………………………………
Wir betraten erwartungsvoll den Büchergarten von Löhne; denn wir wollten…………
Der Verkauf von Ölsardinen in Büchsen verharrt seit drei Jahrzehnten auf niedrigem Niveau.
Wir werden……………………………………………………………………………………………………
Ein Mann nimmt uns mit auf die große Fahrt durch seinen Wahn………………………………
Patient zeigt Schreibverhalten…………………………………………………………………………
Aus der Stimme aller abrufbaren Gedächtnisschaltungen puzzelt sich der Mensch sein “Ich” zusammen…………………………………………………………………………………………………
Ich bin ein Ordnungsfanatiker. Ich bin ein Ordoliberaler. Ich bin ordiniert……………………
Irgendwann gibt man alles ab nach oben………………………………………………………………
……………………………………………………………………und entwickelte es zu einem sinologischen Juwel
……………………………………………………….……………haben Tiere Erwartungen im Blick
…………………………………………………………………………………………………Pechkater.
Die Waldmarie glitt in ihren Sitz geschnallt über den Aufsetzpunkt der Rollbahn von Halifax, Nova Scotia; denn sie wollte zu gern.
schoenfeldt - 11. Dez, 18:11
Wüsste ich nur (wozu?) was ich gefühlt habe, als ich noch nicht wusste (wozu?), dass es mich gibt (wozu?), ich mich – nur spürte, bevor ich mich aufspürte. Wo? Zu? Auf!
Punkt, Fleck, Linie? Schwall? Hinter einer Wand? Vor einem Loch? Einem Loch in der Wand? Einem Loch im Boden? Boden. Der Boden. Ein Bodden. Ein Boden. Mein Boden. Mein Bodden. Treiben über den Hoden. Treiben über den Bütten. Busig. Nebel, und alles war vollkommen. Brodem, Brei, und alles war vollkommen. Wille aus Neben. Wille aus Brei. Busig. Nebel mit Willem aus Brodem. Brei mit Willem. Treiben über dem Brodem. Busig. Die Habe aller Habe. Urhabe. Treiben über dem Boden. Die Habe aller Habe. Urhabe. Busig. Ach Gott, nur Teilhabe, Lottchen. Hinhocken!
Mann! Deine Aufgabe ist Eindringen. Lebenslang eindringen. Lebenslang. Lebenslang. Nichts anderes. Der Stolz auf den Fluch. Der Stolz auf die Drnagsal. Peinlich, das Gedrungenwerden. Das du brauchst. Die Flucht aus dem Urwald.
Angst. Agnus Dei. Anus hominis. Anus mundi.
Nicht einmal Neugier ist geblieben. Die Schnecke zieht es in ihr Haus, bevor sie zertreten wird.
schoenfeldt - 11. Dez, 18:09
Auf den Spuren Fontanes zu wandern, ist, seit dem Ereignis, das sich Wende nennt, eine liebe Lust geworden. Selda, eine Nachbarin, die die gleichen Interessen hat, wie sich herausstellte, schloß sich mir an. Über Fontane und Preußen war eine neue Freundschaft gewachsen.
Wir beschließen, Brandenburg zu besuchen -eine Stadt in einer Entfernung, die unseren bisherigen Horizont überschreitet, weil wir ohne Auto sind. Über die Region Potsdam, wohin man bequem mit der S-Bahn gelangt, sind wir gemeinsam noch nicht hinausgekommen.
In diesen späten Apriltagen ist der Frühling über die Ahnung hinausgetrieben, aber wegen der niedrigen Celsiusgrade noch nicht ganz da, obwohl die Birnbaumsilhouette weißblühend das Blau des Himmels sprengt und die Mandel- und Pfirsichbäumchen in ihrem zerbrechlichen Rosa den Mutterinstinkt in mir wecken. Doch leider benötige ich den Mantel, sie einzuhüllen -und das unterscheidet mich wohl von einer Mutter- selber, um mein Frösteln erträglich zu halten. Die Frühlingsfarben wirken kalt im kaiserblauen Himmel der Mark, die Schatten kontrastieren scharf. Kein Purpurtanz des Frühlings, der mich trunken macht. Kein Erlöschen der Sterne, weil die Blütenkristalle alles andere Glänzen ertränken.
Brandenburg ist eine mittelalterliche Stadt. Für hiesige Verhältnisse alt, backsteinfarben, mit Kopfsteinpflaster. Wir holpern durch die alten Gassen, riechen das Wasser der Havel, die im eigentlichen Sinne kein Fluß ist. Sie ergießt sich aus dem mecklenburgischen Dambecker See, nördlich von Berlin, wie ein gemächlich dahintrödelndes und sich ausuferndes Rinnsal aus einer Wanne; zieht über die Hauptstadt nach Süden. Von Potsdam fließt sie weiter in westlicher Richtung nach Brandenburg, und nach einem nordwärts geschwungenen Bogen vereinigt sie sich bei Havelberg mit der Elbe.
Mein Geburtsfluß Aupa speist auch die Elbe - in Böhmen. Ich spüre den Wind, der von der Schneekoppe in das Aupatal herunterstürzt und ziehe meinen Mantel enger. Die tausendjährige Linde vor dem alten Rathaus Brandenburgs, das damals Brennabor hieß, zittert in ihrem dünnen Kleidchen.
Die Linde - der heilige Baum der Slawen. Hier hat vielleicht Pribislaw, der letzte Hevellerfürst, seiner Liebsten ein Ständchen gebracht. War Pribislaw der Vorfahr meines tschechischen Urgroßvaters? Der eine ist untergegangen mit seinem Stamm in der Germanisierung, der zweite in den Namen der männlichen Deszendenz. Hier vor dem Rathaus umarme ich die Linde. Sag was, Großväterchen! Urgroßväterchen Václav ist verstummt.
Selda und ich haben lange Zeit im Dom zugebracht, der auf Trümmern der Hevellerfeste errichtet wurde. Immer wachsen auf zerstörten Heiligtümern die Symbole der neuen Zeit. Ein Nebeneinander läßt die Geschichte nicht zu!
Wir waren unterkühlt in den feuchten Gemäuern. Waren es mephitische Dünste, die die Wandmalerei beschlugen? Unter der Krypta die Gebeine der slawischen Aufständischen gegen die christlichen Eroberer ihres Brennabor? Spürte ich die Nähe meines Ahnherrn? Was will das lautlose Summen in meinen Adern?
Der Tag neigt sich in den weinroten Abendhimmel. Dieses Rot würde ich verwenden, sollte ich Tränen malen. Es zieht sich in die Furchen am Horizont. Der Zenit verliert sich im tiefen Blau des Universums.
Mir ist kalt. Ich ziehe Selda fort von hier. Habe Angst, ich könnte unseren Zug verpassen. Mir ist so, als läge Brandenburg auf einem anderen Kontinent. Selda erinnert daran, daß wir in der Nähe von Berlin sind und noch eine Stunde Zeit haben.
Ich aber bin unruhig. Der schöne Ort hat plötzlich eine Fratze. Aus dem bröckligen Gemäuer greifen Schlangen nach mir.
Selda bewundert derweil die hübschen Mauerblümchen, die sie an ihre Kindheit auf einem Schloß erinnern, wohin sie nach den Bombenangriffen evakuiert wurden. Ich sehe die eingefallene Mauer am Gehöft meiner Urgroßeltern am Fuße des Riesengebirges. Schweiß tritt auf meine Stirn, obwohl mir eiskalt ist. Ich renne voraus. Meine Freundin kommt gemächlich hinter mir her.
Ich stehe auf den Schienen der Straßenbahn, umgeben von tobenden Autos, deren Reifengeräusche auf den Pflastersteinen meine Ohren malträtieren.
Das ist Folter! schreie ich und stürze in den Waggon einer Straßenbahn.
Selda zerrt mich wieder heraus, weil es die falsche ist.
Meine Knie wabern. Mein Herz rast. Wir verpassen den Zug, Mutti, sage ich wortlos.
Die nächste Straßenbahn ist unsere. Noch eine Viertel Stunde bis zur Abfahrt des Zuges. Selda gackert. Sie hat im Havelstrandrestaurant zwei Gläschen Wein getrunken. Ich setze mich von ihr weg nach vorn. Ihr Hexenkreischen ist mir unerträglich.
Am Bahnhof. Noch fünf Minuten Zeit. Eine Baustelle behindert den Zugang.
Ich finde den Eingang nicht. Kopflos schlage ich mich an die brennende Brust, in der mein Herz wild gegen die Rippen schlägt. Alte Leute brechen sich die Rippen, wenn sie stark husten, hat mein Arzt gesagt, als ich über Schmerzen in der Herzgegend geklagt habe, und er nichts finden konnte. Ich fühle mich steinalt. Der Baustellenzugang zum Bahnsteig wird immer enger, die Bretter versperren die Sicht.
Mutti, komm! rufe ich.
Ich berühre einen fremden Mann, ob er mir den Zug nach Berlin nennen könne.
Er stößt mich zurück. Der stehe dort.
Der Mann ist hinter dir her, Mutti, schreie ich. Das dreijährige Kind stürzt die Treppe hinunter, dann wieder hinauf auf Bahnsteig zwei. Es schlägt gegen das Gepäck der dahinströmenden Menschen.
Seine Knie sind wie Gummibärchen, pappig, der Puls überstürzt sich. Wir schaffen es nicht! Mutti, liebe Mutti...
Die Schaffnerin befiehlt: Einsteigen! Ich reiße ihr die Kelle aus der Hand. Meine Mutter sei noch nicht da. Tränen stürzen auf mein Seidentuch. Der zweite Schaffner rennt die Treppe hinunter.
Eben sei sie noch dagewesen, brülle ich ihm hinterher.
Ich stehe auf dem Trittbrett. Meine Mutter müsse gestürzt sein, sie sei verfolgt worden. Die Schaffnerin schaut mich mitleidig an.
Ihr Kollege kommt außer Atem wieder die Treppe hoch.
Meine Mutter sei nirgends zu sehen. Er müsse jetzt das Abfahrtssignal geben. Wir haben schon zwei Minuten Verspätung.
Er schiebt mich in den Wagen, pfeift und schließt die Tür.
Der Zug setzt sich in Bewegung. Fassungslos presse ich meine Nase an die Fensterscheibe. Die Landschaft zieht vorbei. Zartes märkisches Grün, in den Pfützen auf den Feldern spiegeln sich rosa Wolken.
Erst als jemand die Hand auf meine Schulter legt, wende ich meinen Blick in den Gang. Es ist die Schaffnerin. Sie sieht in mein nasses Gesicht.
Meine Freundin stehe jetzt auf dem Bahnsteig und ich habe die Karten, sage ich zu ihr. Ich hätte doch von meiner Mutter gesprochen, welche Freundin ich denn meine. Die Schaffnerin ist irritiert. Ich gehe in ein Abteil. Ich habe Durst und esse einen Apfel.
Habe ich Mutti gerufen? Warum sollte ich Mutti gerufen haben? Verwirrt und von Schuldgefühlen zerfressen starre ich vor mich hin.
Zu Hause lege ich mich aufs Sofa. Schwere Gedanken stieben durch meinen Erschöpfungsschlaf. Ich bin in einem fremden Land. Ich höre fremde Stimmen, eine Sprache, die ich nicht verstehe. Geschrei. Ein fremder Mann greift nach meiner Mutter. Sie stürzt.
Mutti! stammele ich mit brechender Stimme. Von meinem Röcheln werde ich wach. Ich springe auf. Ich habe das Gefühl, als blute ich inwendig, aber ich spüre auch, daß das Blut meine Wunde wäscht. Woher stammt die Wunde, die heute aufgebrochen ist?
Ich greife das Telefon. Höre Seldas frische Stimme.
Was denn mit mir los gewesen sei. Das war doch gar nicht unser Zug. Wir hatten doch nur Fahrkarten für den Regionalzug, der vom ersten Bahnsteig abfährt. Ich sei in den Fernzug gestiegen. Hat der Schaffner keinen Zuschlag verlangt?
Der Schaffner sei fix und fertig gewesen, antworte ich, weil er meine Mutter gesucht habe.
Mutter? zischt Selda durchs Telefon.
Die frische Luft in Brandenburg sei mir nicht bekommen, das habe zu einem Schock geführt. Selda war mit einem Arzt verheiratet. Wer einen Schock habe, wolle fliehen, könne aber nicht.
Ich war aber auf der Flucht! entgegne ich.
Die Flucht sei ein lustiger Ausflug gewesen oder etwa nicht! Seldas Stimme ist wieder heiter.
Ich antworte ihr mit ungeübter Zunge. Ano, veselý výlet. In diesem Augenblick weiß ich, es ist die fremde Sprache, in der ich als Kind manchmal zu träumen pflegte, die ich jedoch nie gelernt habe und deren Sinn ich nicht verstand. Aber ich weiß, es ist die Sprache von Urgroßväterchen Václav und deshalb ist sie mir nicht mehr fremd.
schoenfeldt - 11. Dez, 18:03
Warum gehen sie nicht schwimmen? Alle schwimmen ihre Bahnen vor und zurück, deshalb sind sie hergekommen. Aber diese Männer sitzen am Beckenrand, planschen mit den Beinen im Wasser und reden die ganze Zeit. Ich wünsche, ich könnte hören worüber sie reden. Ich muss beim nächsten Mal neben ihnen den Beckenrand berühren und so ein wenig lauschen. “Es ist eine Unverschämtheit, dass mein Vorschlag abgelehnt worden ist.” sagte derjenige mit dem Bart. Der mit der Glatze neben ihm nickte verständnisvoll. Als ich mich abstieß und tauchte fragte ich mich, was da wohl abgelehnt worden sei. Beim Auftauchen stieß ich gegen eine Frau mit kurzen Haaren. Ich hatte sie nicht gesehen. Sie schwamm wie ein Delphin. Schnell und kraftvoll. Die beiden Männer am Beckenrand würden nicht auf die gleiche Art schwimmen, dachte ich. Eher wie Wale. Doch welche Wale, Pottwale oder Blauwale? Pottwale sind Jäger in den Tiefen der Meere. Blauwale jedoch schwimmen gemütlich an der Oberfläche und sammeln Krill mit offenem Maul.
Ein schmächtiger Asiate kommt mir entgegen und taucht ab - ein Pottwal, ganz eindeutig. Hinter ihm eine Dame mit bestickter Taucherhaube. Bedächtig schwimmt sie mit unbewegtem Kopf im Becken. Ein klarer Fall: Blauwal.
Mit mir schwimmen also nur drei Spezies in diesem Becken - ich selbst bin ein Pottwal, stoße an den Beckenrand und drücke mich mit aller Kraft ab. Ich ströme durch das blau scheinende Wasser.
Als ich auftauche sehe ich die beiden Männer immer noch am Beckenrand sitzen.
Welcher Vorschlag des bärtigen Mannes wird wohl abgelehnt worden sein? Ein Verbesserungsvorschlag? Ein falscher Vorschlag? Ein zu gut gemeinter Vorschlag?
Nur Blauwale machen Vorschläge. Pottwale tauchen und jagen - bis sie satt sind. Doch haben Pottwale keinen Bart, den haben nur Blauwale, um den Krill besser fangen zu können.
Ich tauchte bis zum Beckenrand und hielt mich diesmal fest. Ich versuchte wieder zu lauschen: “Naja, da hilft alles nichts.” sagte der bärtige und sprang ins Wasser, tauchte wieder auf und verließ das Becken. Er war gar kein Meeresbewohner, sondern ein Kater - macht eine Katzenwäsche und geht nach Hause. Offenbar muss ich mein Verständnis der Artenvielfalt erweitern.
schoenfeldt - 11. Dez, 18:02
Es kommt eine Zeit da vergessen wir alle Sommertage und fast verlieren wir die Erinnerung und das Wissen um den Frühling. Dann droht uns die Dunkelheit, dicht und mächtig, zu verschlucken. Der kalte Regen fällt so nass und still und eine einsame Kälte kriecht unsere feuchten Strümpfe hoch und stinkt in den Bussen und Bahnen. Kein Blick aus strahlenden Augen, kein Lächeln über Sommersprossen. Da ist dann kein Blau und Grün, kein Gelb und Weiß und gar kein Rot, nirgends.
Unser gewohntes Jammern und Schimpfen verstummt im Grau.
Und wenn wir selbst unsere Angst nicht mehr wiederfinden nach dem Schlaf, wenn der Kaffee nicht mehr duftet am Morgen und der Tag nicht mehr lockt...
kommt wie von tausend Wünschen über Nacht die Vorweihnachtszeit, immer gerade noch rechtzeitig.
Wir Großstädter versammeln uns dann- dem uralten Instinkt folgend- um gedeckte Tische und schauen gemeinsam und verlangend in das Licht der vielen Kerzen. Das Feuer weckt zuverlässig unseren Widerstand.
Ein großes, langes Aufatmen öffnet die Türen und die Ohren und die Augen. Wir sammeln alles: Das Funkeln der geschmückten Fenster, die Freude der Weihnachtsmärkte, die Verheißung der Kaufhausmusik. Abends lachen wir über den drohenden Wetterbericht und erwarten aufmüpfig mit frisch geschliffenen Schlittschuhen und nagelneuen Wollmützen die große, lange Kälte.
Wir zählen die Tage und Geschenke. In den unendlichen Nächten trinken wir und singen sehr viel. Dann lieben wir, ernsthaft, heftig.
In den finsteren Fenstern leuchten und blinken und trösten stille Kerzen und elektrische Lichtervergnügen.
Der U-Bahnschaffner wartet extra auf den alten Mann, der sich, bierselig schwankend, nicht bedankt für die geschenkte Zeit.
Die kurzen, dunklen Tage stillen unsere Sehnsucht.
Und alles ist ganz dicht und laut und still im gleichen Ton. Und alle wissen wieder von der Sonne und der ersten Amsel im nächsten Jahr.
schoenfeldt - 11. Dez, 18:00
Interessanterweise spielte auf der diesmaligen Lesebühne Kafkas „Brief an den Vater“ gleich zwei Mal eine Rolle, was dafür spricht, dass dieser Brief für die Literatur lesende Nachkriegsöffentlichkeit, zu der sich die Lesebühnen-Vortragenden Kaune, Ibbeken und Fezer rechnen dürfen, wichtig war. Mehr als geistiger Vater denn als geistiger Sohn (Kafka) entpuppte sich ein anderer Dichter (Rilke) als Widergänger in den Gedichten Fritz Jürgen Kaunes, deren Vortragsweise als angenehm, deren Ähnlichkeit mit dem Ton in Rilkes "Duineser Elegien" jedoch als kritisch empfunden wurden. Der Autor bemerkte, dass er die "Duineser Elegien" nicht gut kenne, der Ton seiner Gedichte ihm ohne besondere Kenntnis Rilkes in den Sinn gekommen sei.
Bei „Erinnerung an Freiburg“ wurde weniger kritisiert als gefragt, was es mit der Rundschau auf sich habe. Kaune erklärte, dass es sich bei der „Rundschau“ (Ausgabe vom 62. Jahrgang, Heft 1) um eine damals noch sehr seltene Zeitungsausgabe gehandelt habe, in der der Brief Kafkas an den Vater (Kaune korrigierte nach der Lesung per Mail: Nicht der "Brief an den Vater" war in jener Ausgabe abgedruckt, sondern Kafkas "Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande", womit obige Bemerkung über die Bedeutung des Kafkaschen Brief an den Vater nicht etwa hinfällig wird, da die Erinnerung Kaunes die Texte vermutlich aus gutem Grund vertauscht hat.) erschienen sei, der großes Interesse nicht nur im Autor, sondern in den universitären Kreisen generell ausgelöst habe. Bei „im Frühling“ entfachte die letzte Zeile des Gedichts die Kritik, dass sie hart am Kitsch vorbei schramme, ein Schlagerrefrain sein könnte, schon oft gehört worden sei.
Hillert Ibbeken las den Prosatext „Der Fehlgriff“ vor, der als eindrücklich und gelungen wahrgenommen wurde. Lediglich die Erwähnung Hindenburgs im Text löste unterschiedliche Meinungen darüber aus, ob sie notwendig sei oder nicht. Der Autor bemerkte, dass die Erwähnung Hindenburgs auch den Geist der Zeit kenntlich machen sollte.
Es folgte Maik Lippert, dessen Gedicht „Bürosucht Arbeit“ beim Publikum gut ankam, das Bild von der Inflation des Weltalls sei gelungen, warum der Autor aber dann von Ballons spreche, sei unklar, was wieder einmal die Frage aufwarf, dass bzw. ob Lyrik immer einen unauflösbaren Rest brauche, um gute Lyrik zu sein.
Am meisten Kritik löste der Text „Mach’s gut, Papa!“ von Gunter Fezer. Zu Widerspruch führte nicht nur die Abwesenheit literarischer Qualität im Text, die – vor allem wohl gemessen an der Kritiklust und –kunst Fezers – erstaune, sondern auch das Modell von (vermeintlich) gelungener Autorität bzw. Erziehung, wie sie im Text propagiert werde. Da sei viel Unausgegorenes, das zu hinterfragen wäre. Fezer erklärte, dass er den Text in Gedanken an Kafkas Brief an seinen Vater formuliert habe. Daraufhin erntete der Autor jene Kritik, die er selbst gerne äußert: ein Text müsse sich von selbst erklären und nicht im Nachhinein von seinem Autor erläutert werden müssen.
Zu bemerken wäre noch, dass hier nicht alle gelesenen Texte genannt wurden. Wir haben der Nachvollziehbarkeit wegen nur jene aufgezählt, für die wir das Einverständnis der Autoren zur Veröffentlichung in unserem Schreibforum einholen konnten.
schoenfeldt - 11. Dez, 17:38
Hillert Ibbeken: Der Fehlgriff
Mein Großvater war ein strenger Mann. Schlank und groß, trug er immer einen dunklen Anzug mit Weste und goldener Uhrkette, seine vollen weissen Haare standen in einem kurzen Bürstenschnitt auf dem Kopf, wie bei Hindenburg. Er mochte gut in den Achtzigern sein, das war im Sommer 1945, ich hatte es damals auf zehn Jahre gebracht. Wir kannten uns noch nicht lange, die Mutter und die Kinder waren gerade erst vor den Russen zu den Großeltern nach Schleswig geflohen. Einige Erlebnisse, man kann es auch Zusammenstösse nennen, hatten mich gelehrt, ihn zu fürchten, und ich bestand aus schlechtem Gewissen, wenn immer ich ihn sah. Er besaß eine große Druckerei, wahrscheinlich war er von Sorgen zerfressen in jenen Tagen und der Abenteuerlust des Zehnjährigen nicht gewachsen.
Im Maschinenhaus der Druckerei trieb eine gewaltige Dampfmaschine über breite Lederriemen ungezählte Druckmaschinen an. Hinter dem Maschinenhaus stand in einem ziemlich verwilderten Garten ein hoher, schmaler Birnbaum, über und über voll mit dicken Birnen, allerdings, wenn ich mich recht entsinne, mit ziemlich grünen und harten Exemplaren, die man, selbst jetzt in der Septemberreife, nur mit den Vorderzähnen raspeln konnte, so hart waren sie. Klar, dass die Birnen für uns tabu waren, gar nicht einmal zu Unrecht, alles Essbare war extrem wertvoll und wir zankten uns darum, die Pellkartoffeln pellen zu dürfen, wenn es welche gab, weil man dann den dünnen Kartoffelschmitz, den das flach eindringende Messer aus der Kartoffeloberfläche löste, als zusätzlichen Genuss vertilgen konnte.
An die Stimmung im sommerlichen Birnengarten erinnere ich mich nicht mehr. Die Stimmung eines Birnbaumgartens ist aber seit Fontane und Herrn von Ribbeck so festgelegt, daß dem kein anderes Bild entgegengesetzt werden muss. Das Bild tut auch nichts zur Sache, ich hatte gerade eine Riesenbirne in meine Hosentasche gestopft, sie saß so stramm darin, dass ich die Hose hätte ausziehen müssen, um sie wieder heraus zu bekommen, als der Großvater den Garten betrat und wie der Löwe auf das Zebra geradeaus und zielstrebig auf mich zukam. Ich war gelähmt. Er lächelte freundlich, jedenfalls kam es mir so vor, vielleicht war er ja auch wirklich freundlich gesonnen, warum immer, oder er war scheinheilig, solange nichts bewiesen war, damit die Wirklichkeit um so schrecklicher hereinbräche, die Entdeckung der die Nähte spannenden Birne in der linken Hosentasche.
Die rechte Hosentasche war allerdings ebenso prall gefüllt, mit einer damals heißgeliebten Zigarettendose, einem zigarettenhohen, ovalen Gefäß der Marke Astor, in das hinein ich Kippen für meinen Vater sammelte. Niemand kann heute mehr den Wert einer Zigarette jener Zeiten ermessen, die Qualen der Raucher ohne Tabak. Alle meine Freunde sammelten damals Kippen.
Der Großvater stand jetzt unmittelbar vor mir und sagte „Na“, sagte er ganz freundlich, „was haben wir denn da?“ Er meinte natürlich „was hast Du denn da“, aber er fraternisierte, ganz wie der Onkel Doktor mit seinem „wo tut es uns denn weh“. Zum Greifen nah, im Wortsinn, war sein Triumph, dem bösen Buben die Birne aus der Tasche zu ziehen, das Schlechte dieser Welt zu brandmarken und den Übeltäter zu vernichten. „Na, was haben wir denn da“, wiederholte er, bückte sich zu mir herab, streckte die Hand aus -- und zog die Niete, er griff nach der Hosentasche mit der Zigarettendose und den Kippen. Er war konsterniert, so konsterniert, dass er die andere Tasche zu examinieren vergaß. Ich stammelte irgendetwas, er aber drehte sich wortlos um und verließ die sommerliche Birnenidylle so schnurstracks wie er gekommen war. Jemand hatte eine Schlacht verloren, ich aber war neu geboren.
schoenfeldt - 13. Nov, 14:31
Bürosucht Arbeit
Moabit West hat noch Räume
Frei
Steht auf dem Boden der U-Bahnstation
Eine Klebefolie
Darauf dunkel
Schuhabdrücke von Eilenden
Unsichtbar dagegen
Die Inflation des Weltalls
Ballon an Ballon
Endlose Knospung
Von Paralleluniversen
© Maik Lippert
Jetzt erschienen “Sehnsucht Provinz“ mit ca. 20 Gedichten
im hochroth Verlag (http://www.hochroth.de/berlin/sehnsucht-provinz/).
Einblick in den Probedruck (Exemplar Nr. 000) unter
http://www.bookrix.de/_mybook-malipp_1282296165.4766399860schoenfeldt - 13. Nov, 14:26
Er liebte es, uns Kinder in den Boden, aus dem wir wild hervor wuchsen, zurückzustampfen. Kaum regte sich ein Kindskopf aus der Furche, schon trat er zu. Nicht mit derben Stiefeln. Nein, mit zartester Erziehung. Die kam in federleichten Sätzen daher. Solchen wie: "Mein Sohn tut so etwas nicht." Es dauerte lange, bis wir Kinder im Zurückstampfen den Vater und im Vater den durch die Vorväter Verdorbenen erkannten. Da wollten wir den Vater retten. Der Eigenwilligste unter uns begehrte mit harten Worten gegen das elende Zurückgestampftwerden auf. "In dich ist wohl der Teufel gefahren!" schimpfte ihn die Mutter. Ihr Zorn auf den Bruder erschreckte uns. Derart von der eigenen Brut getupft verließ der Vater bekümmert das Haus, um Rat einzuholen, wie solchem Widerstand zu begegnen sei. Der um Rat Befragte, ein gelehrter Kindsversteher, erklärte den Aufbegehrer für verrückt. Denn: verschließe man sich dem Erzogenwerden, könne man gar nichts anderes als verrückt sein. Das Leben sei ja kein Zuckerschlecken, man müsse auf seine härtesten Verformungen durch eine womöglich noch härtere Erziehung vorbereitet werden. So oder ähnlich redete der Ratgeber dem Zurückstampfer gut zu. Der Vater aber dachte wohl bei sich, dass dieser da auch einmal zurückgestampft gehöre, ließ es aber sein und behandelte den Bruder von da an wie einen Verrückten, will sagen, er ließ ihm alle Güte angedeihen, zu der ein Vaterherz fähig ist. "Der Papa wird's schon richten", war jetzt seine ständige Rede. So misslang dem Bruder das Leben schließlich ganz. Ach, lieber, lieber Leidensbruder! Wir anderen dagegen hatten Glück im Unglück. Uns ließ der Zurückstampfer weiterhin nichts nach. Kaum waren unsere hellen Köpfchen aus dem Boden, krach, trat er wieder zu. Schließlich gelang es uns aber, ihm zu entkommen. Wie leicht war es doch! Wir krochen durch Maulwurfsgänge bis an das Ende eines Regenbogens. Dann ging's, hui, hoch hinauf bis zum Zenit und schon waren wir über'n Papa weg.
schoenfeldt - 13. Nov, 14:12
im Frühling
was wäre gewonnen, wenn wir sie fänden,
die Unsterblichkeit, - blieben uns nicht nur lauter
gewohnheiten?
Unser Leben: unendliche wiederholung,
unser Herz schlüge nicht mehr schneller
beim erblicken der ersten Kirschblüten.
was hieße dann "zukünftig" (wenn
wir unsterblich wären, sind es die Dinge nicht auch?)
wir erlebten keine Schönheit mehr, denn
die geschieht nur als Ereignis
(sie macht uns staunen)
die Liebe, wo bliebe sie, wenn wir
unsterblich dahin lebten?
(– unzähöige Male das Gesicht
der Geliebten lesen – aber gelänge das?)
wo bliebe die Überraschung, mit der wir,
an einem einsamen Häuschen vorbeigehend
den Klang einer Klaviersonate hörten, der
aus dem offenen Fenster strömt.
aber wir sind's ja nicht. Freilich
bleibt uns nun der Rest, den man
wie's heißt, auslöffeln muß – oder wegschütten,
halt je nachdem,
einige tage voll Sonnenschein könnte es noch
geben oder einen lang erwarteten Brief
Freilich ist's seltsam,
– die Erde bald nicht mehr zu bewohnen,
–zu sehen
wie sich Blatt um Blatt löst
vom Baum des Lebens,
nichts schützt uns vor dem Wind aus dem Unendlichen,
Seltsam nur zu sagen: nimmermehr.
In jedem Herbst blüht noch eine letzte Rose.
schoenfeldt - 13. Nov, 13:59
Erinnerung an Freiburg
Langsam fallen dir wieder
Dinge und Namen ein: die Figur
des Aristoteles auf der Treppe,
das Heft der Neuen Rundschau
vom Frühjahr 1951,
ein Brief an Kafkas Vater,
Namen und Dinge,
Schwabentor und Schauinsland,
Höllental und Todtnauberg.
Die Torten im Café Stoll –
Inseln im Meer des Vergessens,
Langsam fallen wieder
Dinge und Worte ein,
Blicke und Namen –
ein Kuß im Mai,
ein Geständnis im Juni –
was zählt sonst
zu unsern Gunsten?
Rosen, Blicke, Namen,
eine Umarmung im Gras –
sie fallen ein – wie die
Mauersegler über dem Hof.
Vieles aber nicht.
schoenfeldt - 13. Nov, 13:51
Folgende Fragen ergaben sich aus der letzten Lesung der Carmer Eins:
1. Darf Lyrik verständlich sein/muss Lyrik immer Nebelbomben werfen/wie trivial darf Lyrik sein?
2. Darf man Celan sampeln/ Darf man NACH CELAN noch Metaphern verwenden?
3. Sollten romantische Töne in der zeitgenössischen Lyrik ein Tabu sein?
4. Ist Pathos in der Lyrik überholt?
5. Warum macht Lyrik manche Hörer so wütend?
schoenfeldt - 1. Okt, 10:05
Den Beginn der Lesung gestaltete Stephan Schwarz mit fünf unbetitelten, jedoch nummerierten Gedichten, deren Hermetik und Kryptik eine Herausforderung für die rein akustische Annäherung waren. (Ein Problem von Lyriklesungen generell, weshalb wir darum
bitten, Gedichte zukünftig als Kopien unter den ZuhörerInnen zu verteilen.)
Ein sich durchziehendes Thema der Gedichte schien sich jedoch abzuzeichnen: Beim Dichten mit der Versuchung umgehen zu müssen, der Romantik zu verfallen. Dies nicht zu tun, ihr zu widerstehen, nach anderen Formen zu suchen, darum drehten sich die Gedichte mehr oder weniger direkt oder auf einer sich zu erschließenden Metaebene.
Die Gedichte wurden unterschiedlich aufgenommen, manche störten sich an großen Worten („Genius“), andere fanden dies wiederum mutig, einige beklagten die Unzugänglichkeit der Texte, andere lobten ihr Geheimnis. Es kam die Frage auf, ob Lyrik nicht auch kryptisch sein
müsse, da sie sonst zu platt daherkomme und keine Lyrik mehr sei.
Jenny Schon las zwei Gedichte, (hier im Blog nachzulesen), die, wie ein Gast bemerkte, am anderen Ende der Skala von Lyrik stünden, eher zur Gedankenlyrik zu zählen seien. Schon erklärte, dies seien Prosagedichte.
Nicht kryptisch, sondern klar spielt sie mit ihrem Gedicht „Steine virtuell“ auf konkrete historische Bezüge an (Zerstörung der Buddhastatuen in Afghanistan 2001), die sie nach der Lesung erläuterte.
Auch hier fiel die Diskussion kontrovers aus: Ein Gedicht müsse für sich selbst
sprechen und nicht anschließend von seiner Autorin erklärt werden. Ein Klagelied seien die „Steine virtuell“, sagte ein Gast. Bemerkenswert sei der Schluss des Gedichts, in dem den Gigabytes positive Schöpferkraft zugeschrieben (und eben nicht nur der Raub an Realität, ihr Entzug kritisiert) werde, da man sich dank der virtuellen Wiederhergestelltheit der Gesichter
der Buddhastatuen (in einer Ausstellung im Gropiusbau) wieder ein Bild von ihnen machen könne.
Nach der Pause las Jenny Schon auf Wunsch der Gastgeberinnen
ein zweites Gedicht ("Die alten Männer"), das ebenfalls hier nachzulesen ist. Kritisiert wurde das „Gutmenschentum“ und die „Selbstgerechtigkeit“ des lyrischen Ichs, das sich über den alten Mann stelle. Auch sei die Haltung des lyrischen Ichs „zu passiv“, wenn es nur frage, anstatt zu handeln. Fragen sei doch aber etwas sehr Aktives wandten andere ein. Die Haltung dahinter sei eindeutig moralisch und politisch, so die Autorin, und sie stehe auch voll dahinter.
Den Abschluss der Lesung machte Gunter Fezer mit seinem Gedicht „ÖTZI IM LICHTZWANG“ – Sampling Paul Celan – auch hier nachzulesen. Der Autor selbst stellte die Frage ans Publikum, ob man das dürfe, Paul Celan zu sampeln, und erklärte dann selbst das Verfahren seines Gedichts. Er habe vor lauter Überdruss an den Celan-Imitationversuchen vieler junger
Dichter einmal den Versuch machen wollen, in ein selbstverfasstes Gedicht
Metaphern aus Celans „Lichtzwang“ einzufügen, um zu zeigen, dass all die Bemühtheit um
die noch bessere Metapher angesichts der schon erdichteten im Grunde für die Katz sei.
Aber das sei doch ein durchaus produktives Ansinnen, neue Metaphern zu finden, sei auch der Antrieb lyrischer Produktion, sagten Gegenstimmen. Kritisiert wurde der Schluss der Gedichts, der zu albern sei. Albern sei aber doch das ganze Gedicht, hieß es von anderer Seite.
schoenfeldt - 29. Sep, 11:16